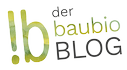Tschakka! Wir haben wieder ein Bauministerium und das federführend in der Hand der Sozialen (und Demokratischen) Partei Deutschlands. Gibt es damit endlich den lang ersehnten sozialen Bauaufschwung für Geringverdiener und Lehrlinge? Oder für die Durchschnittsverdiener, die seit Jahren nach einer bezahlbaren Wohnung in einer bayerischen Stadt suchen? Oder die Älteren, denen ihr 6-Zimmerhaus schon lange eine ziemliche Putz-Last ist und die so gerne in die Nähe der Enkel ziehen würden, aber dort nicht genauso viel Miete für eine barrierefreie 2-Zimmerwohnung zahlen wollen. 400.000 Wohnungen will die neue Regierung bauen.
Gartenstadt des 21. Jahrhunderts
Ich bin unterwegs nach München. Auf dem Weg vom beschaulichen Geltendorf in die City hält die S-Bahn an der neuen Haltestelle Freiham. Dort stand einmal ein bäuerlicher Gutshof auf weitem Agrarfeld. Jetzt entsteht auf einer Fläche, die gefühlt so groß ist wie der Franz-Josef-Strauß-Flughafen in der Schotterpampa des Münchner Nordens, ein neues Stadtgebiet mit viel Vertikale und viel Weiß. Doch auf den Werbewänden mit den stylishen Fotocollagen steht die fertige Siedlung in einer grünen Oase. Und so preist es die Münchner Stadtbaurätin Elisabeth Merk auch an: Hier entsteht die Gartenstadt des 21. Jahrhunderts. Doch was ich sehe sind schwindelerregende Baukräne, Bulldozernde Tiefbaukraken und öde Betonfelder. Und Gingkobäume, eingebettet in 4 qm Pflanzwanne.
Wollen wir die Wohnbedürfnisse aller Menschen mit unserem derzeitigen Standard weitgehend befriedigen, müssen wir Naturflächen roden und so der Erde kostbaren Mutterboden entziehen, müssen immense Flächen zubetonieren und in der Erdkrume kilometerlange Rohre verlegen, um den unstillbaren Hunger an Energie für Wärme, Strom und das kostbare Grundwasser zu stillen.
Und so gibt es allerorten diese Gartenstädte mit Gingkobaum: 3 Zimmer, Küche, Bad. 81 qm, Lüftungsanlage. Ist das wirklich alles, was die Bürgervertretung an Lösungen zu bieten hat?
Was ich in dem Regierungspapier vermisse, ist die Nennung zeitgemäßer Wohnmodelle, alternative Visionen von Menschen, die sich seit geraumer Zeit auch Anderes vorstellen können: Natürlich, Gartenstadt. Aber muss man dazu erstmal alles platt machen, um danach aufwendig das Leben mit der spendablen Natur möglich zu machen? Ist das nachhaltig?
Achja und der Stellplatzschlüssel! Ein SUV verbraucht mehr Standplatz. Hallo? Wir sind in der Sharing-Economy angekommen! Zusammenleben zu beiderseitigem Nutzen. Symbiose nennt das die Biologie.
Gartenstadt 2.0: Smart Home im Green House mit Dachterrasse, wahlweise in 62 qm oder 128 qm. Am Randstreifen der Gartencity dann der Krautgarten. So nannte man das früher. Ist das nachhaltig? Ich finde nicht und höre schon die Rufe: Wieder so ein Verzichtscredo! Was will die denn? Ich will weniger Zerstörung und ein nachhaltiges Maß! Denn urbanes Wohnen geht auch auf kleinerem Raum! Und Selbstversorgung mit natürlichen Lebensmitteln ist auch auf weniger möglich. Solche Modelle gibt es schon lange und es werden langsam wieder mehr. Aber nicht, weil es sich die Politik auf die Fahnen schreibt, sondern weil es die Notwendigkeit hervorbringt.
Siedlungspolitik in Krisenzeiten
Gehe ich durch Schongau, meiner neuen Wohnstadt, sehe ich noch maßvoll große Wohngebäude. Im sogenannten Pfaffenwinkel gab es einmal eine Bergwerksindustrie. In Peißenberg, Peiting und Penzberg zeugen noch kleine Werkhaussiedlungen von einer historischen Baupolitik, die dem Prekariat des Industriezeitalters bessere und gesündere Lebensräume als Ausgleich zur staubigen Arbeitswelt ermöglichen wollte. Was diese Häuschen auszeichnet, ist ihre bescheidene Größe samt Kleingarten. Ausreichend für mehrere Generationen und Krisenzeiten.
Auch in München – ich denke an die alte Maikäfersiedlung oder die Borstei – gab es vor und nach den Weltkriegen Bauprojekte, die als Gartenstadt oder zumindest als Siedlungen mit Gartencharakter, den Zugang zu natürlichen Lebensquellen durch echte Kleingärten im Hinterhof ermöglichen sollte. Was diese Bauformen zudem so attraktiv machte, waren durchdachte Grundrisse, die auf die absolut notwendigen Bedürfnisse zugeschnitten waren und somit den Platzbedarf und damit die Ressource Baumaterial auf ein Minimum reduzierte.
Urban Gardening und Quartiersentwicklung
Im Vergleich dazu Freiham. Oder „Das neue Gartenfeld“, Berlin. Quartiersmanagement ist das neue Zauberwort. Auch die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen sieht in der Gartenstadt ein Zukunftsmodell. So gibt sie in den Leitlinien zur Entwicklung neuer Stadtquartiere an, dass „…grün geprägte Quartiere mit geringer Bodenversiegelung, Dach- und Fassadenbegrünung und neuen Formen urbanen Gärtnerns…“ zu berücksichtigen sind. Aber nicht nur das. „..die Unterstützung von innovativen, gemeinschaftlichen und generationenübergreifenden Wohnformen“ sind zu entwickeln. Immerhin!
Reformbewegung für soziales Wohnen
Vielleicht schielt der Senat zumindest mit einem kleinen Blinzeln in Richtung der ältesten immer noch bestehenden Sozialsiedlung der Welt: die Fuggerei in Augsburg. Seit 1521 leben Bürger der Renaissancestadt für einen symbolischen Mietzins in sehr kleinen Wohnungen mit Gartenanteil. Mitten in der Stadt. Von Generation zu Generation. Der reiche Jakob Fugger spendierte zu seiner Zeit Ackergrundstücke, um den Bau von Stadtsiedlungen für sozial Benachteiligte anzukurbeln. Die Fuggerei funktioniert bis heute auf Basis einer Stiftung.
Auch im 19. Jahrhundert gab es in den wachsenden Städten größere Reformbewegungen, die würdevolleres Wohnen mit Partizipation an der Natur für Menschen aus bescheideneren Verhältnissen ermöglichen soll. Erste Genossenschaften entstanden in den Randzonen der Großstädte. Man kämpfte gegen die Großgrundbesitzer, die auf ihrem Grund und Boden wie die Made im Speck saßen. Und heute? 100 Jahre später sind wir wieder soweit!
Das Einfamilienhausidyll – für wen?
In meinem Bekanntenkreis herrscht beinahe Einigkeit darüber, dass Hühnerhaltung, Kartoffeln anbauen und Äpfel und Birnen zur rechten Zeit zur Saftpresse gekarrt, inzwischen zum guten Ton des Alltags gehören. Doch wer kann das schon in der Stadt? Es sind die Enkelkinder derjenigen, die inzwischen in den Einfamilienhäusern mit größerem Garten der Großeltern außerhalb der Stadt wohnen. Damals gab es noch Platz in den Dörfern und kleinen Städten, und der Gartenzaun markierte viel Luftraum zum Nachbarn. Ist das die Mehrheit?
Das vom GRÜNEN-Politiker Anton Hofreiter so gern gescholtene „Einfamilienhausverbot“ meint im Kern nicht die Enteignung, sondern fordert vielmehr eine Sozial- und Bodenreform für das Gemeinwohl.
Der Journalist Matt Aufderhorst bringt es in einem Beitrag auf Deutschlandfunkkultur auf den Punkt: „Die Leute werden reich und reicher, indem sie Anderen den Wohnraum vorenthalten“.
Es gibt Jahrhundertwende-Villen mit riesigen Gärten, die von alten Menschen mühsam gepflegt und gehegt werden müssen. Nicht nur im Grunewald oder in Grünwald, sondern auch bei uns, vor der Haustüre, mittendrin in den bayerischen Idyllkommunen. Und es gibt Gartenstädte nach Quartiersmanier.
Bauköpfe bewegt euch!
Es muss endlich Bewegung in alle Bauköpfe! 400.000 neue Wohnungen mit dem heutigen Standard (30 qm offene Wohnküche und 18 qm Schlafzimmer) konzipiert, führt zu einem immer weiter in die Höhe treibenden Durchschnittsverbrauch an Wohnfläche pro Kopf. Der liegt in Deutschland inzwischen bei 47 qm! Und so stehen nicht nur für den Papa im Homeoffice, sondern auch für den 5-jährigen Sohn 47 qm Spielwiese zur Verfügung. Der Journalist Aufderhorst fordert daher zu Recht, dass wir uns vom „o8/15 der Wohnschablone befreien müssen“, dass das neue Credo auch sein kann: „Tausche Groß gegen Klein“. Er nennt es „W-Mobilität“.
Wohn-Mobilität
Ich arbeite gerade an einem Modell einer genossenschaftlichen Tinyhaus-Siedlung. Tiny Houses sind der Inbegriff an W-Mobilität! In solch einer Gartenhaussiedlung – die Minihäuser sind ohne den Boden zu versiegeln auf Punktfundamenten erstellt – gibt es immer noch genug Luftraum zum Nachbarn. Der Selbstversorgergarten besteht aus Hochbeeten vor dem Küchenfenster, der Rest kommt über die Gemüsekisten, die wir uns teilen und so eine Menge Geld sparen. Die Gebäudehülle ist im Niedrighausstandard aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz in Serie erstellt – das CO2 damit gebunden – und der erneuerbare Energiebedarf reduziert sich auf ein Minimum pro Kopf. Wir brauchen ja nicht viel! Für ein Leben in Würde reichen 75 Kubikmeter aus. Weniger als in der Maikäfersiedlung.
Doch es bedeutet viel mehr: Flexibilität, Anpassungsmöglichkeiten für den Lauf der Generationen, soziales Miteinander, und all das, ohne sich auf immer und ewig zu verschulden, wie es nur die Reichen können. Man kann ein Tinyhaus auch mieten, auf Zeit oder als Homeoffice. Oder den Urlaub, Car- und Bikesharing inklusive. Und es geht auch 2-geschoßig! Dann nennt man es Mehrfamilienhaus!
Tinyhäusler realisieren die kleinstnötige Wohnform und provozieren eine Bauwende weg vom Raumgreifenden. Insofern sind sie vielleicht Rebellen, aber keine Spinner. Krisenzeiten bringen Notwendigkeiten hervor, und Krisenzeiten bedeuten immer Verzicht. Aber das ist nicht schlimm, es ist nur anders, eben maßvoll! Man braucht halt Mut, und Bereitschaft. Für das wachsende Prekariat ist jetzt der Druck wieder groß genug. Und so werden es immer mehr, die eine soziale, nachhaltige und vor allem raumreduzierte Bodenreform für würdevolles Wohnen fordern und Tiny House-Genossenschaften gründen.
Die neue Regierung bleibt wahrscheinlich weiter wie die Made im Speck sitzen und genehmigt fleißig neue Gartenstädte. Doch vielleicht besucht die neue Bauministerin demnächst die Fuggerei – man kann ja mal hoffen.
Downloads:
https://www.deutschlandfunkkultur.de/wohnungsnot-kreative-loesungen-sind-gefragt-100.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/muenchen-freiham-wiederbelebung-einer-gartenstadt-100.html
https://www.fugger.de/geschichte
https://stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/de/schwerpunkte/index.shtml
Wer schreibt?

Ilka Mutschelknaus ist Innenarchitektin und Baubiologin IBN. Nachdem sie 10 Jahre lang sachverständige Beratung zu "erkrankten" Häusern durchführte, steckt sie jetzt ihr Herzblut in die Beratung für baubiologische Tiny Häuser mit der Vision, dass dadurch gesundes und bezahlbares Wohnen für Alle möglich werden kann. Sie lebt und wirkt in Schongau, das liegt im malerischen Pfaffenwinkel. Mehr über Ilka
Diesen Beitrag teilen:
Mehr zu diesem Thema:
Wer schreibt?

Ilka Mutschelknaus ist Innenarchitektin und Baubiologin IBN. Nachdem sie 10 Jahre lang sachverständige Beratung zu "erkrankten" Häusern durchführte, steckt sie jetzt ihr Herzblut in die Beratung für baubiologische Tiny Häuser mit der Vision, dass dadurch gesundes und bezahlbares Wohnen für Alle möglich werden kann. Sie lebt und wirkt in Schongau, das liegt im malerischen Pfaffenwinkel. Mehr über Ilka